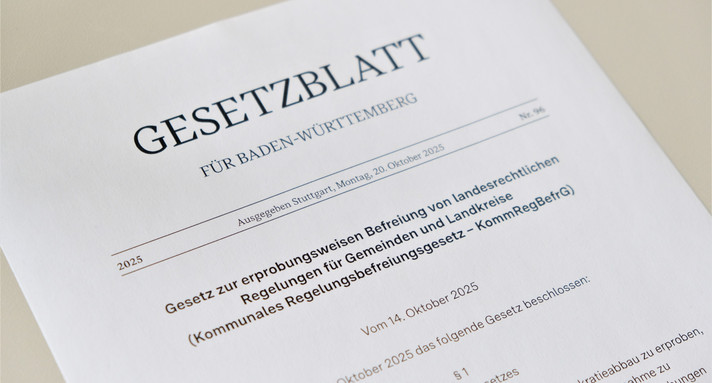Das Gesetz ist am 21.10.2025 in Kraft getreten. Das Kommunale Regelungsbefreiungsgesetz soll mit Hilfe des kommunalen Sachverstands einen Beitrag zum Bürokratieabbau in Baden-Württemberg leisten. Es eröffnet Gemeinden, Landkreisen und Zweckverbänden die Möglichkeit, auf Antrag von landesrechtlichen Regelungen abzuweichen, die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinden und Landkreise und der Aufgaben der unteren Verwaltungsbehörden erlassen wurden. Auf diese Weise sollen jeweils im Einzelfall über einen bestimmten Zeitraum von höchstens vier Jahren neue Formen der Aufgabenerledigung oder des Aufgabenverzichts erprobt werden können. Eine Befreiung bedarf der Genehmigung des fachlich zuständigen Ministeriums. Erfolgreiche Erprobungen können in der Folge gegebenenfalls landesweit und dauerhaft umgesetzt werden.
Weitere Informationen zum Kommunalen Regelungsbefreiungsgesetz und zum Antrags- und Genehmigungsverfahren:
Kommunales Regelungsbefreiungsgesetz – GBl. 2025, Nr. 96 (PDF)
Den Gesetzestext finden Sie auch auf der Internetseite Landesrecht BW.
Gesetzentwurf der Landesregierung – Drucksache 17/9087 (PDF)
Die vollständige Dokumentation zum Gesetzgebungsverfahren finden Sie hier.
Ziel des Gesetzes ist es, neue Maßnahmen zum Bürokratieabbau zu erproben, auszuwerten und erfolgreiche Modelle für eine landesweite Übernahme zu prüfen. Zu diesem Zweck lässt das Gesetz für einen begrenzten Zeitraum Abweichungen von landesrechtlichen Regelungen zu, um den Kommunen die Erprobung neuer Lösungen bei der Aufgabenerledigung und der kommunalen Zusammenarbeit zu ermöglichen und um zu testen, ob damit Verwaltungsverfahren beschleunigt, vereinfacht und kostengünstiger gestaltet werden können. Ein weiteres Ziel des Gesetzes ist es, den Kommunen erprobungshalber zu ermöglichen, den Herausforderungen des demografischen Wandels flexibel und mit örtlich angepassten Lösungen bei der Aufgabenerledigung zu begegnen.
Das Gesetz ist ein Erprobungsgesetz, das bis zum 31.12.2030 befristet ist. Der Zweck als Erprobungsgesetz soll insbesondere auch ermöglichen, die auf kommunaler Ebene vorhandene Sachkompetenz zu erschließen. In der kommunalen Praxis sollen abweichende Möglichkeiten für die durch landesrechtliche Regelungen vorgegebene Aufgabenerfüllung entwickelt und umgesetzt werden können, sofern nicht bestimmte Ausschlussgründe entgegenstehen. Erfolgreiche Erprobungen können in der Folge im jeweiligen Fachrecht landesweit und dauerhaft umgesetzt werden.
Regelungen im Sinne des Gesetzes sind einzelne Vorschriften in Gesetzen, Rechtsverordnungen und Verwaltungsvorschriften des Landes, die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinden und Landkreise und der Aufgaben der unteren Verwaltungsbehörden erlassen wurden.
Der potentielle Anwendungsbereich ist also sehr weit und umfasst nicht nur Personal-, Sach- und Verfahrensregelungen, sondern grundsätzlich alle landesrechtlichen Regelungen, welche die kommunale Aufgabenerfüllung und die Erfüllung der Aufgaben der unteren Verwaltungsbehörden betreffen.
Eine darüberhinausgehende Befreiung von landesrechtlichen Vorgaben für die Aufgabenerfüllung durch Landesbehörden oder von Vorgaben, die für privatwirtschaftliche Unternehmen oder für alle Bürgerinnen und Bürger gelten („Jedermanns-Pflichten“), ist allerdings nicht möglich. Eine Abweichung oder Befreiung von einem Gesetzesziel oder vom Zweck einer Regelung ist ebenfalls nicht möglich.
Auch ein Aufgabenverzicht kann Gegenstand einer Befreiung sein. In diesem Fall darf durch den Verzicht auf die Aufgabe das übergeordnete Ziel des die Regelung beinhaltenden Gesetzes bzw. der Rechtsverordnung oder der Verwaltungsvorschrift als Ganzes nicht gefährdet werden. Durch eine Befreiung von Regelungen dürfen die Aufgabenerfüllung und die damit verbundenen Kosten auch nicht auf andere Stellen außerhalb der antragstellenden Kommune abgewälzt werden; dies gilt insbesondere im Falle eines Aufgabenverzichts.
In anderen Gesetzen des Landes enthaltene sogenannte Erprobungsparagrafen oder Experimentierklauseln für Kommunen, wie zum Beispiel § 11 des Kindertagesbetreuungsgesetzes, gehen als gesetzliche Spezialregelungen für die Aufgabenerfüllung der Kommunen den Regelungen des KommRegBefrG vor. Solche Spezialregelungen sind für die dort vorgesehenen sachlichen Anwendungsbereiche vorrangig und abschließend anzuwenden.
Eine Befreiung von Vorschriften des Bundesrechts oder des Rechts der Europäischen Union ist mangels Gesetzgebungskompetenz des Landes nicht möglich.
Ein Antragsrecht besteht nach dem Gesetz für Gemeinden und Landkreise. Das Gesetz gilt für Zweckverbände entsprechend.
Den Antrag kann für eine Gemeinde die Bürgermeisterin / der Bürgermeister bzw. die Oberbürgermeisterin / der Oberbürgermeister und für einen Landkreis die Landrätin / der Landrat stellen, für einen Zweckverband die / der Verbandsvorsitzende. Der Antrag kann auch von der Stellvertreterin / von dem Stellvertreter oder einer entsprechend beauftragten Mitarbeiterin / einem entsprechend beauftragten Mitarbeiter gestellt werden. Die Zuständigkeit der Landrätin / des Landrats besteht auch für Anträge, die sich auf die Aufgaben des Landratsamts als untere Verwaltungsbehörde beziehen. Der Gemeinderat ist über die Antragstellung und über eine erteilte Genehmigung unverzüglich zu unterrichten; für den Kreistag gilt dies nur, soweit dessen Zuständigkeit betroffen ist.
Der Gemeindetag Baden-Württemberg und der Städtetag Baden-Württemberg können jeweils stellvertretend für mehrere Gemeinden und der Landkreistag Baden-Württemberg kann stellvertretend für mehrere Landkreise Anträge nach dem Gesetz stellen. Träger der Anträge bleiben die jeweiligen Kommunen als verantwortliche Aufgabenträger. Anträge der kommunalen Landesverbände können von einer organschaftlichen Vertreterin / einem organschaftlichen Vertreter oder einer vertretungsberechtigten Mitarbeiterin / einem vertretungsberechtigten Mitarbeiter gestellt werden.
Ein Antrag muss folgende Angaben enthalten:
- Nennung der landesrechtlichen Regelungen, von denen abgewichen werden soll,
- Angabe zur Dauer der Erprobung,
- Angaben zur Art und Weise, mit der der Zweck der Regelungen und ihrer übergeordneten Ziele auf andere Weise als durch ihre Erfüllung erreicht werden können. Die antragstellende Kommune trifft nur die Pflicht, diesen Punkt in dem Antrag schlüssig nachvollziehbar darzulegen. Sie hat also lediglich eine Darlegungslast, eine Beweislast trifft sie insoweit nicht. An den Inhalt des Antrags sind insofern keine überspannten Anforderungen zu stellen.
Eine besondere Form ist für den Antrag nicht vorgeschrieben. Die Kommunen können Anträge formlos (zum Beispiel per E-Mail) stellen. Auch das weitere Antrags- und Genehmigungsverfahren kann digital abgewickelt werden.
Der Antrag ist an das jeweils fachlich zuständige Ministerium zu richten. Die Zuständigkeit ergibt sich aus der Bekanntmachung der Landesregierung über die Abgrenzung der Geschäftsbereiche der Ministerien. Die Anschriften und E-Mail-Adressen der Ministerien können dem Landesportal entnommen werden.
Über den Antrag ist zwingend innerhalb von drei Monaten nach Eingang der erforderlichen Antragsunterlagen zu entscheiden.
Das zuständige Ministerium übermittelt der antragstellenden Kommune nach Eingang eines Antrags unverzüglich eine Eingangsbestätigung. Sofern festgestellt wird, dass bei einem Antrag erforderliche Angaben fehlen, hat die antragstellende Kommune die Gelegenheit, erforderliche Angaben nachzureichen. Die Dreimonatsfrist beginnt erst zu laufen, sobald dem zuständigen Ministerium sämtliche erforderliche Angaben vorliegen.
Zur Verfahrensbeschleunigung sieht das Gesetz zudem eine Genehmigungsfiktion vor. Sollte das zuständige Ministerium über einen vollständigen Antrag innerhalb von drei Monaten ab Eingang beziehungsweise ab Vollständigkeit des Antrags keine Entscheidung treffen, gilt die Genehmigung für die beantragte Dauer als erteilt.
Die Entscheidung über einen Befreiungsantrag wird der antragstellenden Kommune innerhalb der Genehmigungsfrist schriftlich oder in Textform mitgeteilt.
Das Gesetz soll einen möglichst großen Beitrag zum Bürokratieabbau leisten. Bei der Beurteilung vorliegender Anträge sind die oben dargestellten Ziele des Gesetzes und sein Erprobungscharakter jeweils zu berücksichtigen. Das Gesetz geht im Grundsatz davon aus, dass Anträge möglichst genehmigt werden sollen, es sei denn, es stehen gewichtige Gründe entgegen.
Dem Antrag soll daher im Einklang mit den Zielen dieses Gesetzes stattgegeben werden, es sei denn, es würde eine Gefahr für Leib und Leben von Menschen entstehen oder es stehen überwiegende Belange des Gemeinwohls entgegen.
Für die Ablehnung eines Antrags müssen daher Umstände vorhanden sein, welche die Annahme rechtfertigen, dass durch die Befreiung von Regelungen eine Gefahr für Leib und Leben von Menschen entstehen würde oder überwiegende Belange des Gemeinwohls – wie zum Beispiel. das ordnungsgemäße Bekanntmachungs- und Beurkundungswesen oder der einheitliche Vollzug des Landesbeamtenrechts (insbesondere Besoldungs-, Versorgungs-, Laufbahnrecht) – entgegenstehen.
Die Gemeinwohlformel trägt der Erkenntnis, dass vielfach widerstreitende öffentliche Interessen aufeinandertreffen, mit einem Abwägungsmodell Rechnung. Die Frage, ob ein Erprobungsantrag aus überwiegenden Gründen des Gemeinwohls abgelehnt werden kann, kann nur das Ergebnis einer Abwägungsentscheidung nach den Umständen des Einzelfalls sein, bei der in Rechnung zu stellen ist, dass eine Ablehnung allenfalls in Betracht kommt, wenn Gründe des öffentlichen Interesses von besonderem Gewicht dies rechtfertigen.
Höherrangiges Recht wie das Bundesrecht, das Recht der Europäischen Union oder Rechte Dritter, insbesondere Beteiligungsrechte und gesetzlich erworbene subjektive Rechtspositionen, dürfen einer Befreiung nicht entgegenstehen. Anträge auf Abweichungen, die gegen das Bundesrecht, das Recht der Europäischen Union oder Rechte Dritter verstoßen würden, müssen daher in jedem Fall abgelehnt werden.
Im Fall einer Ablehnung hat die Genehmigungsbehörde darzulegen, inwieweit Versagungsgründe vorliegen. Die Beweislast dafür, ob ein Versagungsgrund vorliegt, trifft die Genehmigungsbehörde.
Beabsichtigt das zuständige Ministerium die teilweise oder gänzliche Ablehnung eines Antrags, so hat es rechtzeitig vor Ablauf der Genehmigungsfrist zunächst gemeinsam mit dem Innenministerium auf eine Verständigung hinzuwirken. Ist das Innenministerium selbst für die Entscheidung über den Antrag zuständig, hat dieses gemeinsam mit dem Staatsministerium auf eine Verständigung hinzuwirken.
Das Verständigungsverfahren ermöglicht es, die tatsächlichen Interessenlagen der antragstellenden Kommune für eine Befreiung einerseits und die Interessen der Genehmigungsbehörde an einer Beibehaltung der Rechtslage andererseits zu ermitteln, zu hinterfragen und darauf aufbauend mögliche Kompromisse zu entwickeln, welche die Interessenlagen der Beteiligten und die rechtlich möglichen Gestaltungsformen in größtmögliche Übereinstimmung bringt. Die Regelung wird also von dem Grundsatz getragen, dass eine Erprobung zu ermöglichen und zu fördern ist.
Stehen einer Genehmigung Hindernisse entgegen, ist auf mögliche Veränderungen des Antrags hinzuwirken, um eine Genehmigung zu ermöglichen. Eine entsprechende Initiative, gemeinsam mit der antragstellenden Kommune eine Genehmigungsfähigkeit des Antrags zu erreichen, kann das zuständige Ministerium selbstverständlich bereits im Rahmen der Antragsprüfung ergreifen; im Erfolgsfall würde das Verständigungsverfahren entbehrlich.
Kann ein Einvernehmen nicht erzielt werden, verbleibt die Letztentscheidung beim zuständigen Ministerium.
Wird eine Genehmigung erteilt oder gilt sie als erteilt, so macht das zuständige Ministerium dies unter Bezeichnung der Regelungen, die Gegenstände der Befreiung sind, und des Zeitraums der Erprobung im Gemeinsamen Amtsblatt bekannt. Das Gemeinsame Amtsblatt kann über das Landesrecht BW abgerufen werden.
Die Bekanntmachung dient der Information der Bürgerinnen und Bürger, der Wirtschaft und der anderen Kommunen über die Abweichung von Regelungen und damit der Transparenz. Im Nebenzweck kann das Interesse bei anderen Kommunen an der Erprobung geweckt werden.
Ergänzend werden erteilte Genehmigungen zukünftig auch an dieser Stelle fortlaufend veröffentlicht.
Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen:
- Befreiung von § 5 Absatz 2 Satz 1 der Gemeindehaushaltsverordnung (Angabe der Gesamtzahl der Stellen für das Vorjahr sowie der am 30. Juni des Vorjahres besetzten Stellen für die einzelnen Besoldungs- und Entgeltgruppen im Stellenplan).
- Befreiung von § 51 Absatz 1 Satz 1 des Landesbeamtengesetzes und § 1 Absatz 1 der Beurteilungsverordnung (Absehen von der Regelbeurteilung für kommunale Beamtinnen und Beamte unter gewissen Voraussetzungen).
- Befreiung von § 24 Absatz 4 Satz 3 der Kommunalwahlordnung (Verwendung gelber statt hellroter Wahlbriefumschläge bei der Durchführung der Bürgermeisterwahl einschließlich einer etwaigen Stichwahl).
- Befreiung von § 14 Absatz 1 der Gemeindekassenverordnung unter Auflage (Annahme von Spenden der Fahrgäste im Rahmen des Betriebs eines Bürgerautos).
- Befreiung von § 5 Absatz 2 Satz 1 der Gemeindehaushaltsverordnung (Angabe der Gesamtzahl der Stellen für das Vorjahr sowie der am 30. Juni des Vorjahres besetzten Stellen für die einzelnen Besoldungs- und Entgeltgruppen im Stellenplan).